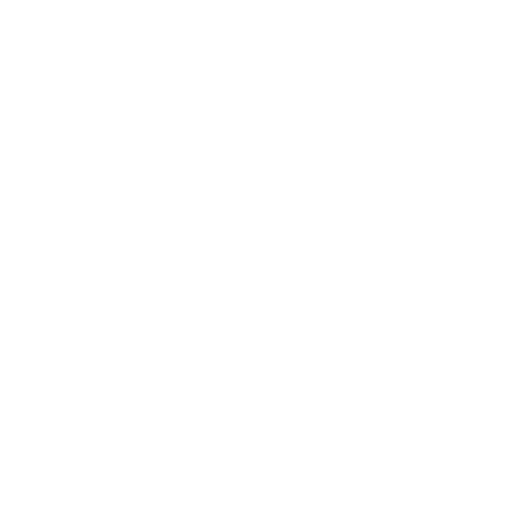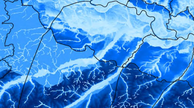Fachgespräch im Rahmen des Bewässerungsforum Bayern
Wasserentnahmen für die Bewässerung - Gewinnung von Uferfiltrat
Termin: Donnerstag, 22. Mai 2025
Durchführung: Online per Cisco-Webex, 135 Teilnehmer
Referentin: Frau Kathrin Moser, Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) in Hof, Referat 96 - Wasserversorgung: Trinkwasserschutz, Grundwasserbewirtschaftung, Hydrogeologie
Für die Bewässerung bekommt die Verwendung von Uferfiltrat immer mehr Bedeutung. Bei der Errichtung von Brunnen, mit dem Ziel Uferfiltrat zu gewinnen, sind vor allem Wechselwirkungen zwischen dem Grundwasser und dem Oberflächengewässer relevant. Diese Wechselwikungen sind vielfältig, sehr vom Einzelfall abhängig und betreffen sowohl die Wassermenge, als auch die Qualität. Allgemein gültige Aussagen zur Errichtung und dem Betrieb von Brunnen zur Gewinnung von Uferfiltrat können daher kaum getroffen werden. Im Rahmen des Fachgesprächs wurden die Zusammenhänge näher erläutert.
Im Sinne einer nachhaltigen Bewirtschaftung des Wasserhaushalts ist bei der Errichtung neuer Bewässerungsanlagen die Priorisierungshierarchie in Hinblick auf die Herkunft des Wassers zu Bewässerungszwecken zu berücksichtigen. Der Wasserbedarf für Bewässerungszwecke ist demnach vorrangig aus Niederschlagswasser, Oberflächengewässern oder Uferfiltrat zu decken. Sind niedrige Abflüsse in Oberflächengewässern während der Bewässerungssaison zu erwarten, ist das benötigte Wasser in Zeiten hoher Wasserführung zu gewinnen und zu speichern. Erst wenn die vorangegangenen Möglichkeiten nachweislich ausgeschöpft sind oder nicht zur Verfügung stehen, ist eine Entnahme aus dem Grundwasser aus fachlicher Sicht grundsätzlich genehmigungsfähig.
Als Uferfiltrat wird das Wasser bezeichnet, das aus oberirdischen Gewässern in das Grundwasser eindringt und nach einer Untergrundpassage entnommen wird. In der Kolmationsschicht des Gewässerbetts und entlang der anschließenden Fließstrecke im Grundwasser wird das Wasser filtriert und natürlich gereinigt. Zur Nutzung der Wassergewinnung durch Uferfiltration werden in der Regel in Ufernähe eines Oberflächengewässers Brunnen errichtet.
Bei der Errichtung von Brunnen, mit dem Ziel Uferfiltrat zu gewinnen, ist vor allem die Interaktion zwischen dem Grundwasser und dem Oberflächengewässer von besonderer Bedeutung bzw. bedeutend davon abhängig. Diese Interaktionen sind komplex, vielfältig und betreffen sowohl die Wassermenge, als auch die Qualität. Brunnen in Gewässernähe unterliegen nicht zwangsläufig einer dauerhaften Uferfiltratbeeinflussung, welche jeweils abhängig vom Fließgeschehen im Untergrund ist. Insbesondere in ausgeprägten Hoch- und Niedrigwasserphasen kann die Fließrichtung und das hydraulische Gefälle variieren. Ein Einwirken auf eines der Systeme (Grundwasser, Oberflächengewässer) hat Einfluss auf das jeweils andere System. Daher ist für eine effektive Wasserbewirtschaftung eine Berücksichtigung der bestehenden Zusammenhänge erforderlich.
Im Fachvortrag wurden die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Grundwasserleiter und Oberflächengewässer in Hinblick auf das Themenfeld Uferfiltrat aus quantitativer Sicht erläutert.
ZUM FACHVORTRAG (PRÄSENTATIONSFOLIEN) VON KATHRIN MOSER, LFU
Im Anschluss an das Fachgespräch beantwortete Frau Moser die Fragen der Teilnehmenden:
FRAGEN - ANTWORTEN
Können bei der Verwendung von Uferfiltrat höhere Entnahmemengen genehmigt werden als bei der Verwendung von Grundwasser?
Die Festlegung von Entnahmemengen für die Bewässerung ist abhängig vom vorhandenen Wasserdargebot unter Berücksichtigung des Wasserbedarfs. Bei der Vergabe von Wasserrechten ist das gesamte Wasserdargebot in Verbindung der bestehenden Wasserentnahmen zu berücksichtigen. Bei der Errichtung von Brunnen zur Förderung von Uferfiltrat sind die Zusammenhänge und teils komplexen Wechselwirkungen zwischen Grund- und Oberflächenwasser zu betrachten. Ob der Wasserbedarf gedeckt werden kann, hängt grundsätzlich von diesen Randbedingung im Einzelfall ab.
Wie hoch sind im Zusammenhang mit der Genehmigung einer Wasserentnahme als Uferfiltrat die Kosten für ein hydrogeologisches Gutachten?
Ob und in welchem Umfang ein hydrogeologisches Gutachten im Zusammenhang mit der Genehmigung einer Wasserentnahme (Uferfiltrat) erforderlich ist, hängt von den bestehenden Kenntnissen hinsichtlich der Austauschprozesse und der Interaktion zwischen dem Grund- und Oberflächenwasser im Einzelfall ab. Daher sollte im Vorfeld und in Vorbereitung eines Wasserrechtsantrags mit der Kreisverwaltungsbehörde eine Antragsberatung vereinbart werden. Im Regelfall wird das örtlich zuständige WWA einbezogen. Weitere Information können auf der Internetseite des LfU abgerufen werden (Informationsblatt + Checkliste).
Lässt sich die Uferfiltrat-Wassermenge vorab quantifizieren?
Sofern entsprechende Daten zur Quantifizierung des Grundwasser-Oberflächenwasseraustauschs vorhanden sind, kann seitens der Fachbehörden im Rahmen der Begutachtung bereits vorab überschlägig der Anteil der jeweiligen Ressourcen (Oberflächenwasser, Grundwasser) bestimmt werden. Dies ist jedoch abhängig vom Einzelfall. Gegebenenfalls sind weitere Untersuchungen bzw. weiterführende Unterlagen erforderlich, welche mit der Kreisverwaltungsbehörde, die ggf. das WWA fachlich beteiligt, abzustimmen sind.
Mit welchem Zeitrahmen muss man für das Genehmigungsverfahren eines Uferfiltratbrunnens rechnen?
Das Genehmigungsverfahren unterscheidet sich grundsätzlich nicht von Genehmigungsverfahren anderer Wasserbezüge (Oberflächenwasser, Grundwasser). Aufgrund der Betrachtung und Berücksichtigung zweier Ressourcen sind ggf. weitere Untersuchungen erforderlich, die je nach Einzelfall zu längeren Genehmigungsverfahren führen können. Aus diesem Grund wird im Vorfeld der Beantragung eine Antragsberatung mit der Kreisverwaltungsbehörde, die im Regelfall das örtlich zuständige WWA einbezieht, empfohlen.
Welche Vorteile bietet die Entnahme von Uferfiltrat gegenüber der reinen Grundwasserentnahme?
Uferfiltrat wird aus Brunnen in unmittelbarer Nähe von Flüssen oder Seen gewonnen. Darin enthalten ist auch ein Anteil von landseitigem Grundwasser. Uferfiltrat ist demnach das Wasser, das dem Brunnen durch das Ufer eines Flusses oder Sees im Untergrund nach Bodenpassage zusickert und sich mit dem anstehenden Grundwasser vermischt. Bei dieser Form der Gewinnung werden die reinen Grundwasservorkommen entlastet. Ein Vorteil gegenüber der direkten Entnahme aus dem Oberflächenwasser stellt die natürliche Reinigung in der Untergrundpassage (Uferfiltration) dar.
Wie wird Verdunstung dem lokalen Wasserhaushalt "gutgeschrieben"?
Die Wasserbilanz eines Gebietes stellt vereinfacht das Gleichgewicht zwischen Niederschlag, Verdunstung und Abfluss dar. Anhand dieses Gleichgewichts lässt sich abschätzen, ob in einem Gebiet natürlicherweise viel oder wenig Wasser zur Verfügung steht. Was die Wasserbilanz ist und was der Klimawandel damit zu tun hat, ist z. B. auf der Internetseite des LfU ausführlich erläutert.
Bei einer direkten Entnahme aus dem Gewässer (und ggf. Winter-Speicherung) wäre ein Grundwasseranteil ausgeschlossen (bis auf die Reduktion des Beitrags zur Grundwasserneubildung) - wäre das eine Alternative?
Bei der Herkunft des Wassers zu Bewässerungszwecken gilt die Priorisierungshierarchie. Demnach ist in erster Linie eine Bewässerung mit gespeichertem Niederschlagswasser und mit aus oberirdischen Gewässern in abflussreichen Zeiten abgeleitetem und gespeichertem Wasser anzustreben. Ist dies nicht möglich, sollte zunächst eine Bewässerungsentnahme aus Uferfiltrat geprüft werden. Erst, wenn das ebenfalls nicht möglich ist, kann oberflächennahes Grundwasser als Ressource geprüft werden. Deshalb ist mit dem wasserrechtlichen Antrag eine Alternativenbetrachtung, welche u. a. eine direkte Entnahme aus einem Gewässer beinhaltet, gemäß der Priorisierung der Herkunft von Bewässerungswasser vorzulegen. Hier kann sich der Anschluss an einen Wasser- und Bodenverband als aus wasserwirtschaftlicher Sicht beste Alternative ergeben, sofern der Verband ausreichend Bewässerungswasser zur Verfügung stellen kann und der Anschluss wirtschaftlich darstellbar ist.
Kann Beregnungswasser aus Uferfiltrat PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) enthalten?
Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) sind in der Umwelt außerordentlich stabil (persistent) und mittlerweile in Spuren in den verschiedensten Umweltmedien nachweisbar (ubiquitäre Hintergrundbelastungen). Großflächige wie auch kleinräumige PFAS-Umwelteinträge unterschiedlichster Ursachen können sich lokal und regional sehr unterschiedlich auswirken.
--
Regionale Erzeugung
Um die pflanzliche regionale Erzeugung weiterhin zu ermöglichen und zu verbessern, wurde von verschiedenen Seiten allgemein angemerkt, dass unabhängig von der Bewässerung grundsätzliche Maßnahmen erforderlich sind, die den oberflächlichen Abfluss vermindern und das Wasser in der Fläche bzw. im Boden halten. In diesem Zusammenhang wurde die immer weiter zunehmende Versiegelung als Problem angesprochen, die den Oberflächenabfluss fördert.
Wasser- und Bodenverbände
Eine grundwasserunabhängige Versorgung mit Wasser zur Bewässerung ist durch Einzelbetriebe oft schwierig umsetzbar. Ein Hemmnis sind insbesondere die zu Beginn hohen Investitionskosten. Die Errichtung von Speicherbecken benötigt geeignete Flächen und zu entsprechend leistungsstarken Oberflächengewässern oder potenziellen Entnahmestellen von Uferfiltrat sind z. T. größere Distanzen zu überwinden. Darüber hinaus müssen für die Verlegung von Leitungen Grundstücke Dritter in Anspruch genommen werden. Wasser- und Bodenverbände können bei der Lösung dieser örtlichen oder regionalen Bewässerungsprobleme helfen. Als Solidargemeinschaft können die in einem Verband zusammengeschlossenen Landwirte eine gemeinsame Bewässerungsinfrastruktur in ihrem Verbandsgebiet (stufenweise) aufbauen und betriebswirtschaftlich erfolgreich betreiben, wie die vielen Beispiele in anderen Bundesländern oder auch im bayerischen Knoblauchland zeigen. Ein professionell betriebener Bewässerungsverband mit entsprechendem Monitoring der Wassernutzungen ermöglicht i.d.R. längere Genehmigungsdauern beim Wasserrechtsbescheid. Dies bedeutet eine größere betriebswirtschaftliche Sicherheit für die Verbandsmitglieder und weniger Neugenehmigungsaufwand für die Behörden.